Haben Sie Teil 4 unserer „Neuro-mentale Gesundheit”- Reihe, „Trauma: Geschichte, Biologie und Genesung”, verpasst? Lesen Sie hier weiter.
Warum uns Stress und Trauma bei epiAge überhaupt beschäftigen? Weil schlechte neuromentale Gesundheit uns bis in den Kern unserer Zellen altern lässt. Tatsächlich wirkt Trauma nicht nur auf den einzelnen Menschen, sondern kann in krasseren Fällen über mehreren Generationen epigenetisch nachwirken.
++++
Was wäre, wenn der Stress und das Trauma, das Ihre Eltern oder Großeltern erlebt haben, einen viel größeren Einfluss auf Ihre körperliche und psychische Gesundheit hätte, als Sie sich das jemals vorstellen könnten? Und was wäre, wenn diese Auswirkungen sogar Ihre genetische Veranlagung für bestimmte Krankheiten übertrumpfen würden? Würde Sie das zu einem „Nebenopfer” der Traumata, die Ihre Vorfahren erlebt haben, machen? Und wären Sie dazu verdammt, gegen einen Feind zu kämpfen, den Sie nie persönlich kennengelernt hätten?
Dies sind nur einige der grundlegenden Fragen, die derzeit die Bereiche Genetik und Epigenetik in Bezug auf akuten Stress und Traumata aufwühlen... Tauchen wir also gleich ein!
Wäre es nicht einfacher, Stress und Traumata aus dem Weg zu gehen, anstatt die Folgen davon zu behandeln, um sich ein gesundes und sorgloses langes Leben zu sichern?
Das ist die provokante Frage, mit der wir Sie in unserem letzten Beitrag über die Auswirkungen von Traumata und potenzielle Heilungswege zurückgelassen hatten.
Tatsächlich hat unsere intensive Auseinandersetzung mit der neuromentalen Gesundheit gezeigt, dass unsere Begegnungen mit Stress und Traumata potenziell bleibende und lähmende Narben in unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden hinterlassen können.
Ist es also ein Hirngespinst zu glauben, wir könnten alle existentiellen Bedrohungen und Traumata aktiv vermeiden?

Die kurze Antwort lautet wahrscheinlich „Ja”, weil das Leben für uns zwangsläufig böse Überraschungen bereithält. Und wahrscheinlich haben wir nur wenig Einfluss auf die Art dieser Herausforderungen – vom Tod eines geliebten Menschen bis hin zu allen möglichen natürlichen und vom Menschen verursachten Katastrophen.
Aber je nach Intensität, Dauer und Schichtung von Stress und Trauma sowie unseren verfügbaren Ressourcen können wir möglicherweise trotzdem beeinflussen, wie stark diese Herausforderungen uns beeinträchtigen. Daher kann der Aufbau einer Form von Resilienz ein erreichbares Ziel sein.
Bevor wir jedoch diese Möglichkeit weiterverfolgen, sollten wir zunächst festhalten, dass wir leider nicht alle gleich geboren sind, wenn es um Stress und Trauma geht.
Wir stellen uns Babys gerne als „unbeschriebene Blätter” vor, wenn sie auf die Welt kommen, auch wenn wir wissen, dass viele von ihnen unter so schlimmen Umständen geboren werden, dass noch bevor sie die Augen öffnen können, sie zwangsläufig negativ beeinflusst werden.
Leider sind Babys bei der Geburt jedoch alles andere als unbeschriebene Blätter, selbst wenn sie in scheinbar harmonische und gesunde Familien hineingeboren werden. Tatsächlich sind Föten nicht nur für aktuelle Krankheiten und Leiden ihrer Eltern bereits empfänglich, sondern sie tragen auch die genetische Last ihrer elterlichen Abstammungslinien in Form einer Neigung zu bestimmten Schwächen oder Krankheiten. Darüber hinaus wissen wir, dass die Art und Weise, wie sie geboren werden – ganz zu schweigen vom Stress der Geburt selbst – einen nachhaltigen Einfluss auf ihr Mikrobiom und andere physiologische Parameter haben kann.
Noch beunruhigender ist jedoch die jüngste Entdeckung, dass Traumata eine verkörperte generationsübergreifende Dimension haben können. Eine Dimension, die tiefer greift als die kulturellen oder familiären Erzählungen, Erziehungsstile oder Familiendynamiken, die zur Formung der sich entwickelnden Selbstidentität und Gesundheit eines Kindes beitragen.

Es sind also offenbar nicht nur unser unmittelbares Umfeld oder unsere persönlichen Erfahrungen, die uns nach unserer Geburt mit Stress oder Traumata prägen können. Wir können in friedliche und angenehme Verhältnisse hineingeboren werden und dennoch unbewusst mit generationsübergreifenden Traumata schwer belastet sein.
Wie wird es dann weitergegeben, wenn nicht nur durch die persönlichen Erfahrungen und Verhaltensweisen der Eltern? Ist es durch die Geschichten über Krieg, Entbehrung oder Diskriminierung, die von anderen Familienmitgliedern weitergegeben werden oder die die jeweilige Kultur durchdringen?
In unserer vorherigen Folge haben wir entdeckt, dass Trauma nicht nur auf die Psyche beschränkt ist, sondern auch greifbare physiologische Auswirkungen hat, darunter unter anderem neurologische, endokrine und entzündliche Symptome. Daher ist es nicht so weit hergeholt, sich vorzustellen, dass Eltern mit einer stark gestressten oder traumatisierten Physiologie einige deren Eigenschaften an ihre Nachkommen weitergeben können.
Diese Frage beschäftigte Forscher bereits nach dem Zweiten Weltkrieg und zunehmend auch nach dem Vietnamkrieg. Dr. Rachel Yehuda, Professorin für Psychiatrie und Neurowissenschaften, war eine der Pionierinnen, die begann, die verkörperte Erfahrung von Traumata sowie deren potenzielle generationsübergreifende Dimension in beiden Kontexten zu untersuchen (für einen Überblick siehe z. B. Yehuda, 2022). Zusammen mit anderen Forschern konnte sie zeigen, dass sowohl Veteranen als auch Holocaust-Überlebende häufig eine Störung der HHN-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse) aufwiesen. Dies konnte in Form eines Cortisolüberschusses oder -mangels auftreten, was sie für eine potenziell chronische posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) prädisponierte.
Eine noch auffälligere Entdeckung war jedoch, dass viele Kinder von Holocaust-Überlebenden ebenso wie ihre Eltern nicht nur Cortisol-Ungleichgewichte aufwiesen, sondern auch affektive oder Angst-Störungen, wodurch sie für PTBS auch anfälliger waren. Diese Erkenntnis wurde später durch eine kleine Studie mit schwangeren Frauen und ihren Nachkommen bestätigt, die den Anschlägen vom 11. September ausgesetzt waren.
In der Zwischenzeit hat die Forschung eindeutig gezeigt, dass eine elterliche Störung der HNN-Achse zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Komplikationen bei Kindern führen kann, von z. B. veränderter Gehirnstruktur und Genexpression bis hin zu Immun- und Stoffwechselstörungen sowie einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Stress.

Daher scheint das generationsübergreifende Trauma eindeutig mit hormonellen Veränderungen zusammenzuhängen. Aber auch andere körperliche Übertragungswege wurden und werden noch erforscht, wie beispielsweise Veränderungen in der Qualität der Keimzellen (die sich dann zu Eizellen und Spermien entwickeln) und nicht zuletzt in der Epigenetik.
Wenn es um die Untersuchung der verkörperten Übertragung von Traumata geht, ist es die Epigenetik, die in den letzten Jahren die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Warum ist das so?
Die Epigenetik ist wohl eine der zentralsten Schnittstellen im Körper. Sie hilft ihm, die Homöostase oder das innere Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig an schwankende äußere Bedingungen anzupassen – seien diese nun kurzlebiger oder dauerhafter Natur.
Lange Zeit wurde angenommen, dass die DNA den entscheidenden Schlüssel zum Gesundheitszustand eines Menschen in sich birgt. Die aufstrebende Wissenschaft der Epigenetik konnte aber nachweisen, dass die Gesundheit zwar teilweise von der Veranlagung beeinflusst wird, aber noch viel mehr von der Umwelt im breitesten Sinne. Somit bestätigte sie die Urintuition von Präventivmedizinern seit der Antike.
Einfach ausgedrückt ist Epigenetik also das System von biochemischen Schaltern (Methylierung, Histonmodifikation, RNS), die die Expression bestimmter Gene entlang eines DNA-Strangs aktivieren oder stummschalten.
Aber was verstehen wir unter „Umwelt”, wenn wir von Epigenetik reden? In diesem Zusammenhang umfasst die Umwelt eines Menschen nicht nur seine Lebensweise, sondern auch seine Erziehung, Familienkonstellation, Arbeitssituation, seinen geophysikalischen Lebensraum, usw. – kurz gesagt, seine gesamten biopsychosozialen Umstände.
Während also die genetische Ausstattung eines Menschen eine relativ stabile Hardware darstellt, die sich über Generationen hinweg langsam entwickelt, stellt die Epigenetik die dynamischere Software dar. Als Gatekeeper interagiert sie ständig mit der Umwelt und passt sich ihr an, um sicherzustellen, dass das biologische System flexibel genug bleibt, um zu überleben und hoffentlich auch zu gedeihen. Diese Interaktion wird beispielsweise durch neuronale oder endokrine Bahnen ermöglicht. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Einbahnmechanismus, sondern um einen hochgradig interaktiven und selbstregulierenden Prozess. So wie die Epigenetik eines Menschen seine Neurobiologie steuern kann, so beeinflusst auch seine Neurobiologie seine Epigenetik in einem sich ständig weiterentwickelnden Dialog.

Konkret bedeutet dies, dass Ihnen die Epigenetik hilft, mit besonders herausfordernden Umständen zunächst fertigzuwerden, seien es äußere Umstände wie Krieg oder Hungersnot oder eher persönlichere Umstände wie häusliche Gewalt oder Missbrauch. Dies geschieht, indem die Epigenetik vorübergehende Veränderungen in Ihrem Stoffwechsel unterstützt, die Ihnen helfen zu fliehen, zu kämpfen, zu erstarren oder sich anzupassen.
In der Regel sollten sich die epigenetischen Markierungen um Ihre Gene allmählich und auf natürliche Weise auflösen, nachdem die Bedrohung vorüber ist. Wenn der Stress (oder das Trauma) jedoch besonders brutal oder anhaltend war, kann das, was als vorübergehende Anpassung gedacht war, so sehr in Ihrem epigenetischen Profil „verankert” sein, dass es Sie dauerhaft beeinträchtigen kann. Tatsächlich wurden bereits unzählige Studien zu den langfristigen epigenetischen Auswirkungen von negativen Ereignissen auf Einzelpersonen (von der Kindheit bis ins hohe Alter) und Gemeinschaften (insb. Minderheiten) veröffentlicht. Diese zeigen ein gestiegenes Krankheitsrisiko, eine biologische Alterungsbeschleunigung und eine erhöhte Sterblichkeit auf (vgl. z. B. Zannas & al., 2015 oder Smith & al., 2024).
Noch auffälliger und ernüchternder ist jedoch die Tatsache, dass diese epigenetischen Auswirkungen unbewusst an die nächste(n) Generation(en) weitergegeben werden können.
Bis vor kurzem war es aus einer Reihe von Gründen schwierig, die epigenetische Dimension des generationsübergreifenden Traumas nachzuweisen.
Tatsächlich wurde anfangs angenommen, dass epigenetische Markierungen nach der Empfängnis vollständig umprogrammiert werden. Zwar unterliegt die Epigenetik eines Embryos einer erheblichen Umstrukturierung, doch ist mittlerweile klar, dass einige der Markierungen bestehen bleiben – sei es in Form von Methylierung, Histonmodifikation oder RNS-Aktivität.
Darüber hinaus handelte es sich bei den ersten epigenetischen Untersuchungen zu generationsübergreifenden Traumata hauptsächlich um Tierstudien, da es schwierig war, ethisch vertretbare Studien am Menschen zu konzipieren. Ein berühmtes Beispiel war die Studie der Emory University, an der eine erste Generation von Mäusen darauf konditioniert wurde, den Duft von Kirschblüten mit der Angst vor einem Elektroschock zu verbinden. Die zweite Generation assoziierte den Duft zwar nicht direkt mit Schmerz, reagierte jedoch sichtbar hippelig, wenn sie mit dem Geruch konfrontiert wurde – obwohl sie von nicht konditionierten „Pflegeeltern” aufgezogen worden war. Und selbst die dritte Generation war für diesen bestimmten Duft noch deutlich sensibilisiert (Dias & al., 2013).

Auch wurden wegweisende humane Studien zum Thema Epigenetik und historisch bedingte Hungererfahrung basierend auf niederländischen, chinesischen und schwedischen Kohorten in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht (vgl. z. B.: De Rooij & al., 2021; Shen & al., 2019; Vågerö & al., 2018). Zwar konnten alle Studien generationsübergreifende Auswirkungen nachweisen, doch variierten diese Auswirkungen stark, sowohl nach Geschlecht als auch Zeitpunkt, zu dem die erste Generation von einer Hungersnot betroffen war (sprich vor der Empfängnis, bei der Empfängnis, im Mutterleib oder später im Leben). Darüber hinaus waren die meisten Auswirkungen negativ. Beispielsweise wurden die schwerwiegenden Folgen pränataler Unterernährung mit Folgen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas und Diabetes im mittleren Alter hervorgehoben. Andere Auswirkungen erwiesen sich jedoch als überraschender. In den schwedischen Studien, die auf eine spätere Exposition gegenüber Hungersnöten fokussiert waren, erwiesen sich nicht alle Auswirkungen auf die Nachkommen als schädlich. Einige der Kinder und Enkelkinder von Männern, die vor der Pubertät einer Hungersnot ausgesetzt waren, schienen schützende Effekte gegen Gesamtmortalität und Krebssterblichkeit zu genießen. Ob diese begrenzte Erkenntnis allerdings die potenziell adaptive Natur der epigenetischen Evolution beweist, bleibt eine heiß debattierte Frage.
Derzeit entstehen immer mehr Studien, die sich auf generationsübergreifendes Trauma (wie anhaltende Diskriminierung oder Krieg) konzentrieren, das größere Gemeinschaften erlebt haben. Eine aktuelle Studie über drei Generationen syrischer Flüchtlinge in Jordanien ist die erste, die zeigen konnte, dass Gewalt die Epigenetik in drei Lebensphasen beeinflussen kann – auf Keimzellebene sowie durch pränatale und direkte Erfahrung. Und diese epigenetischen Gewaltsignaturen konnten bei nachfolgenden Generationen teilweise auch nachgewiesen werden (Mulligan & al., 2025).
Trotz dieser vielversprechenden ersten Ergebnisse ist die epigenetische Dimension von generationsübergreifendem Trauma noch ein sehr junges Forschungsgebiet, und viele grundlegende Fragen bleiben offen. Allerdings eröffnet sie faszinierende neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von Genetik und Epigenetik, auf die Ursachen von nicht übertragbaren Krankheiten sowie auf mögliche zukünftige Heilmodalitäten.
Da sich die Epigenetik mit den Auswirkungen von Traumata auf das menschliche Epigenom noch primär beschäftigt, ist es noch schwierig vorherzusagen, welche epigenetischen Therapien entwickelt werden könnten, um den Auswirkungen von Traumata im Kern unserer Zellen entgegenzuwirken.
Dennoch ist es kein reines Wunschdenken mehr zu hoffen, dass in naher Zukunft revolutionäre Traumainterventionen entwickelt werden könnten. Tatsächlich hat die Forschung zur Epigenetik des Alterns sowie zur Epigenetik von Krankheiten bereits gezeigt, dass epigenetische Veränderungen nicht nur dynamische, sondern auch reversible Prozesse sind, die durch gezielte Lebensstilinterventionen gesteuert werden können. Selbst biologisches Altern, das durch Stress verursacht wird, neigt dazu, sich auf natürliche Weise abzubauen, sobald der Auslöser verschwunden ist (z.B. Poganik & al., 2023). Es ist also durchaus denkbar, dass chronischer Stress oder Traumata bald epigenetisch behandelt werden könnten.

In der Zwischenzeit sind Personen und Gemeinschaften, die extrem widrigen Ereignissen indirekt ausgesetzt wurden, nicht dazu verdammt, Lasten zu tragen, die nicht zu ihnen gehören sowie diese weiterzugeben. Genau wie Traumata aus erster Hand können auch die psychologischen und physiologischen Auswirkungen von vererbten Traumata durch eine Vielzahl von etablierten und neuen Therapien behandelt werden – von der traumainformierten kognitiven Verhaltenstherapie (TI-CBT) über die Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bis hin zur Prolonged Exposure (PE), wie in unserem vorherigen Beitrag bereits beschrieben.
Selbst für Personen und Gemeinschaften mit eingeschränktem Zugang zu modernsten Therapien ist die Pflege eines gesunden Lebensstils (einschließlich einer ausgewogenen Ernährung, Bewegung, gutem Schlaf, Achtsamkeit oder Stressbewältigung) ein entscheidender erster Schritt. Parallel dazu ist der Aufbau von Resilienz von zentraler Bedeutung, um ein unterstützendes inneres und äußeres Umfeld zu gewährleisten – sei es durch die positive Stärkung der Identität, den Aufbau sozialer Netzwerke, die Förderung gesunder Beziehungen, die Schaffung sinnvoller und heilender Rituale oder die Suche nach neuen Zielen und Perspektiven.
Was wäre also, wenn Resilienz über einen optimierten Lebensstil hinaus der wahre Schlüssel zu gesunder Langlebigkeit wäre? Entdecken Sie in unserem nächsten Beitrag einen Fahrplan zur Resilienzförderung!
++++
Quellen und weiterführende Literatur
Ryan, J., Chaudieu, I., Ancelin, M. L., & Saffery, R. (2016). "Biological Underpinnings of Trauma and Post-Traumatic Stress Disorder: Focusing on Genetics and Epigenetics". Epigenomics, 8(11), 1553–1569. doi:10.2217/epi-2016-0083. Online: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2217/epi-2016-0083
“Key findings: Study finds epigenetic changes in children of Holocaust survivors”. U.S. Department of Veteran Affairs. October 20, 2016. Online: https://www.research.va.gov/currents/1016-3.cfm
Yehuda, Rachel. “How Parents’ Trauma Leaves Biological Traces in Children: Adverse experiences can change future generations through epigenetic pathways”. Scientific American, July 1st 2022. Online: https://www.scientificamerican.com/article/how-parents-rsquo-trauma-leaves-biological-traces-in-children/
Jiang S, Postovit L, Cattaneo A, Binder EB, Aitchison KJ. “Epigenetic Modifications in Stress Response Genes Associated with Childhood Trauma”. Front Psychiatry. 2019 Nov 8;10:808. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00808. Online: https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2019.00808/full
Kim K, Yaffe K, Rehkopf DH, et al. “Association of Adverse Childhood Experiences With Accelerated Epigenetic Aging in Midlife”. JAMA Netw Open.2023;6(6):e2317987. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.17987. Online: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2805934
Smith AK, Katrinli S, Cobb DO, et al. “Epigenetic Age Acceleration and Disparities in Posttraumatic Stress in Women in Southeast Louisiana: NIMHD Social Epigenomics Program”. JAMA Netw Open. 2024;7(7):e2421884. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.21884. Online: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2821613
Buckley, L., Turiano, N., Sesker, A., Butler, M., & O'Súilleabháin, P. S. (2024).“Lifetime trauma and mortality risk: A systematic review”. Health Psychology, 43(4), 280–288. doi:10.1037/hea0001343. Online: https://psycnet.apa.org/fulltext/2024-42615-001.html
Lim S, Nzegwu D, Wright ML. "The Impact of Psychosocial Stress from Life Trauma and Racial Discrimination on Epigenetic Aging—A Systematic Review". Biological Research For Nursing. 2022;24(2):202-215. doi:10.1177/10998004211060561. Online: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10998004211060561
Zeming Wu, Jing Qu, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu. “Stress, epigenetics, and aging: Unraveling the intricate crosstalk”. Molecular Cell, Volume 84, Issue 1, 2024,34-54. doi:10.1016/j.molcel.2023.10.006. Online: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276523008092
Zannas, A.S., Arloth, J., Carrillo-Roa, T. et al. “Lifetime stress accelerates epigenetic aging in an urban, African American cohort: relevance of glucocorticoid signaling”. Genome Biol 16, 266 (2015).doi:10.1186/s13059-015-0828-5. Online: https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-015-0828-5
Henriques, Martha. “Can the legacy of trauma be passed down the generations?”. BBC. 26 March 2019. Online: https://www.bbc.com/future/article/20190326-what-is-epigenetics
Dias, B., Ressler, K. “Parental olfactory experience influences behavior and neuralstructure in subsequent generations”. Nat Neurosci 17, 89–96 (2014). doi:10.1038/nn.3594. Online: https://www.nature.com/articles/nn.3594
De Rooij, S. R., Bleker, L. S., Painter, R. C., Ravelli, A. C., & Roseboom, T. J. (2021). “Lessons learned from 25 Years of Research into Long term Consequences of Prenatal Exposure to the Dutch famine 1944–45: The Dutch famine Birth Cohort”. International Journal of Environmental Health Research, 32(7),1432–1446. doi:10.1080/09603123.2021.1888894. Online: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09603123.2021.1888894
Shen L, Li C, Wang Z, Zhang R, Shen Y, Miles T, Wei J, Zou Z. “Early-life exposure to severe famine is associated with higher methylation level in the IGF2 gene and higher total cholesterol in late adulthood: the Genomic Research of the Chinese Famine (GRECF) study”. Clin Epigenetics. 2019 Jun 10;11(1):88. doi:10.1186/s13148-019-0676-3. Online: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6558811/
Vågerö, D., Pinger, P.R., Aronsson, V. et al. “Paternal grandfather’s access to food predicts all-cause and cancer mortality in grandsons”. Nat Commun 9, 5124 (2018). doi:10.1038/s41467-018-07617-9. Online: https://www.nature.com/articles/s41467-018-07617-9
González-Rodríguez, P., Füllgrabe, J. & Joseph, B. “The hunger strikes back: an epigenetic memory for autophagy”. Cell Death Differ 30, 1404–1415 (2023). doi:10.1038/s41418-023-01159-4.Online: https://www.nature.com/articles/s41418-023-01159-4
Cummings, Mike. “Violent experiences alter the genome in ways that persist for generations”. YaleNews, Mar 6, 2025. Online: https://news.yale.edu/2025/03/06/violent-experiences-alter-genome-ways-persist-generations
Mulligan, C.J., Quinn, E.B., Hamadmad, D. et al. “Epigenetic signatures of intergenerational exposure to violence in three generations of Syrian refugees”. Sci Rep 15, 5945 (2025). doi:10.1038/s41598-025-89818-z. Online : https://www.nature.com/articles/s41598-025-89818-z
Ali Jawaid, Martin Roszkowski, Isabelle M. Mansuy. “Chapter Twelve - Transgenerational Epigenetics of Traumatic Stress”. Progress in Molecular Biology and Translational Science. Ed. Bart P.F. Rutten. Cambridge (MA): Academic Press. Volume 158, 2018, Pages 273-298. doi:10.1016/bs.pmbts.2018.03.003. Online: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S187711731830053X?via%3Dihub
Jesse R. Poganik, Bohan Zhang, Gurpreet S. Baht, Alexander Tyshkovskiy, Amy Deik, Csaba Kerepesi, Sun Hee Yim, Ake T. Lu, Amin Haghani, Tong Gong, Anna M. Hedman,Ellika Andolf, Göran Pershagen, Catarina Almqvist, Clary B. Clish, Steve Horvath, James P. White, Vadim N. Gladyshev, “Biological age is increased by stress and restored upon recovery”, Cell Metabolism, Volume 35, Issue 5,2023, 807-820.e5, doi:10.1016/j.cmet.2023.03.015. Online: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550413123000931
Divya Mehta, Dagmar Bruenig, John Pierce, Anita Sathyanarayanan, Rachel Stringfellow, Olivia Miller, Amy B. Mullens, Jane Shakespeare-Finch. “Recalibrating the epigenetic clock after exposure to trauma: The role of risk and protective psychosocial factors”. Journal of Psychiatric Research, Volume 149,2022, 374-381. doi:10.1016/j.jpsychires.2021.11.026. Online: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395621006750
Abbildungen
cottonbro / pexels & epiAge
Yaroslav Shuraev / pexels
Josh Willink / pexels
Ahmed Akacha / pexels
Giantas Paragus / pexels
Prosper Mbemba Koutihou / pexels
cottonbro / pexels
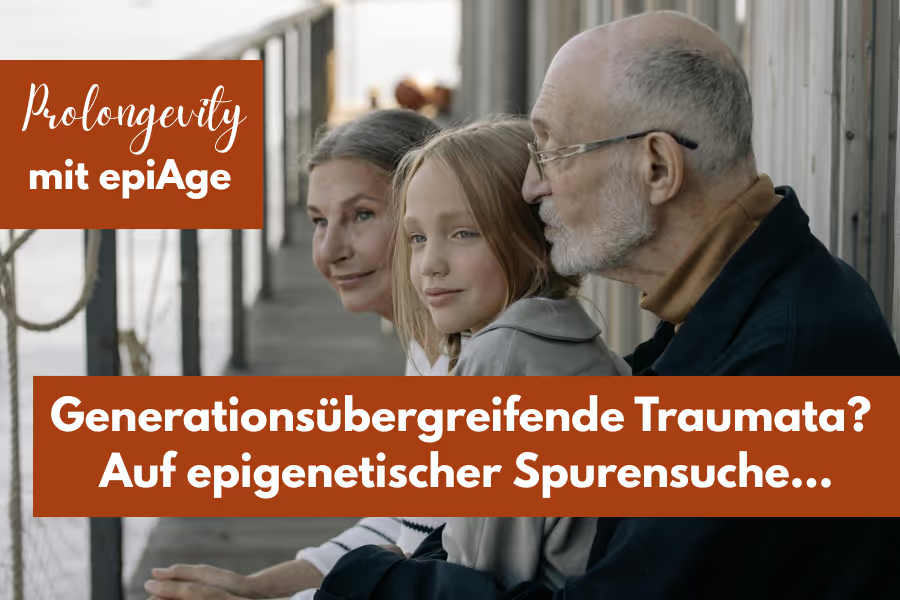 Zurück zur Übersicht
Zurück zur Übersicht